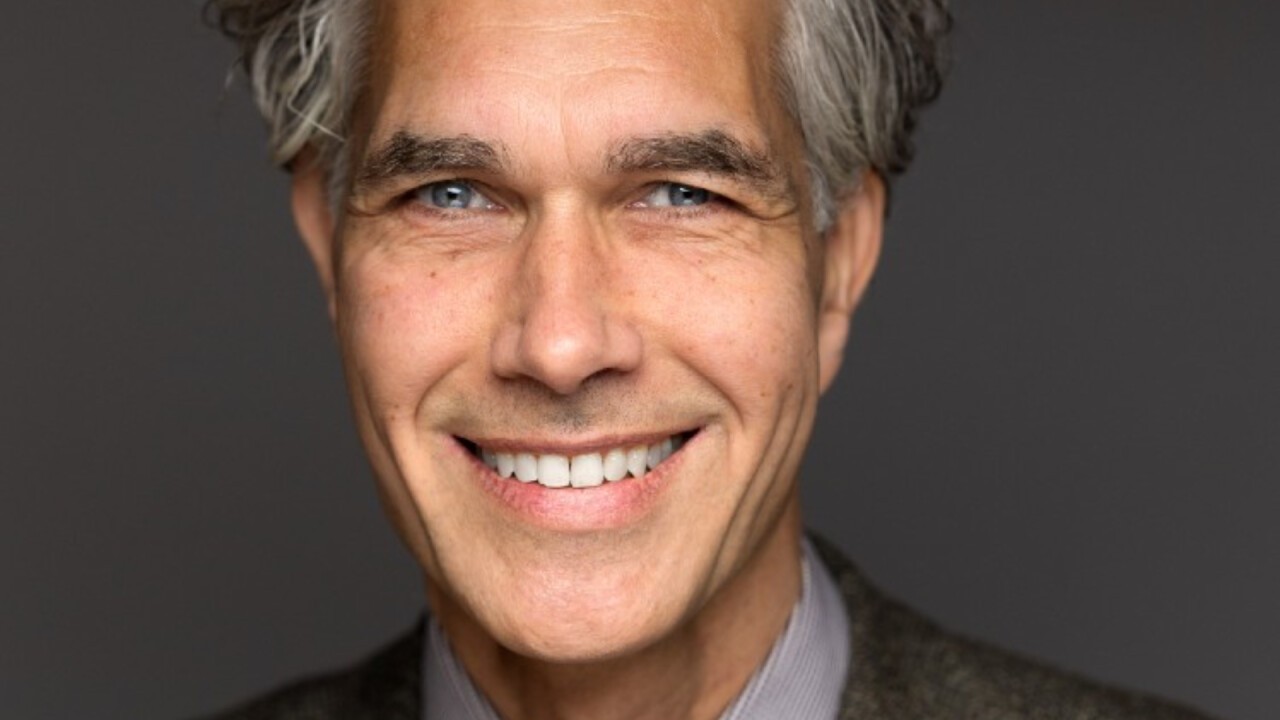Die Energie der Vorstellungskraft oder eine Ode an das Solarpanel
Transformation ist eine Kernfunktion im Verteilnetz. Die damit verbundenen Akteure müssen sich jetzt selbst transformieren. Wie gelingt das? Jörg Metelmann forscht seit einigen Jahren an der HSG zu gesellschaftlicher Transformation. An den Powertagen wird er über die Zukunft der Branche sprechen.
Interview: Bruno Habegger
Herr Metelmann, gestaltet man seine Zukunft mit Manifestation? Das ist gerade auf TikTok ein Trend.
(Lacht) Der Glaube versetzt bekanntlich Berge, aber damit allein erfüllt sich das Glück der Zukunft leider noch nicht. Es braucht einen langen Atem. Transformationen dauern Generationen. In der karbonkapitalistischen Welt leben wir seit gut 150 Jahren – der Wandel kann nicht von heute auf morgen passieren.
Aber wer sich etwas vorstellt, der hat schon mal gute Karten.
Imagineering verbindet die Vorstellung mit der Umsetzung und uns im Westen fehlt ein wenig der Möglichkeitssinn. Deshalb haben wir, Harald Welzer und ich, den Begriff auch von Walt Disney wieder in die Gesellschaft zurückholen wollen: Dort müssen wir gemeinsam träumen, nicht nur in den Themenparks in Peter Pans Phantasieschlössern.
Wer sich etwas vorstellt, kann es auch erfinden? Wie in Star Trek?
Ja, seinem Traum folgen und ihn nachbauen. Ohne Star Trek gäbe es ja vielleicht die Mobiltelefone oder Tablets oder die ganze Techno-Imagination des Silicon Valley gar nicht. Doch diese Vorstellungswelten werden immer mehr privatisiert und kommerzialisiert. Der viel zu früh verstorbene Anthropologe und Aktivist David Graeber hat das mal schön beschrieben: Als Kind hoffte er auf fliegende Autos und als Professor fuhr er noch immer mit der U-Bahn. Die grossen Privilegien, die wir zum Beispiel auch in der Schweiz geniessen, scheinen uns müde und apathisch zu machen.
Träumen Ihre Kinder oder Ihre Studenten von anderen Dingen?
Meine Kinder sind 10 und 13, die möchten noch so sein wie der Papa (lacht), das ändert sich dann in der Pubertät, auch wenn die Fragen nach Alternativen schon jetzt lauter werden. Interessant ist vielmehr, dass auch meine Studierenden Mitte zwanzig noch dieselben Träume haben wie die ältere Generation: Eigenheim, zwei Autos, geregelte Urlaubsflugreisen. Die wüssten eigentlich, wie man einen kleineren Fussabdruck erzielt und wiederholen den alten Lebensstil. Den Traum der Mittelschicht, der global zum Alptraum zu werden droht.
Wie ändern wir das?
Wir sind ja alle in die Mittelschichtenwelt hineingewachsen, auch ich. Träume werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Utopie eines Lebens ohne Mangel ist zu unserer Normalität geworden, und das im Verlauf von 250 Jahren – unfassbar! Genau diese Normalität ist nun aber das Problem. Wie wollen wir künftig leben, wenn wir wissen, dass die Routinen des Konsumalltags nicht nachhaltig sind?
Mit noch mehr Technologie? Immerhin haben sich Wissenschafter weltweit von Fantasien oder ihren Visionen anregen lassen.
Wir schwimmen der Bugwelle der technischen Entwicklung hinterher. Sie gibt uns die Träume, sie lässt die Kultur kippen. Denken Sie an das iPhone – es gibt eine Welt vor dem 9.1.2007 und eine danach. Nahezu alles Soziale hat sich dadurch verändert, vom Busfahren bis zum Konzertbesuch, von der Freundschaft bis zum Sex. Das techno-soziale Motto hiess immer «Connecting», aber westliche Gesellschaften sind gespaltener denn je. Wir müssen technische Innovation viel stärker als soziale Innovation denken und uns fragen, welche Konsequenzen das für unser Leben haben könnte – und ob wir das wollen.
Um Bilder geht es in den aktuellen Energiediskussionen vor der Abstimmung zum Stromgesetz am 9. Juni. Um Landschaftsbilder.
Landschaften sind euphorisch aufgeladene Bilder der Vergangenheit, die mit dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft entstehen. Doch das Bild der Landschaft ändert sich. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, sehe ich Stauseen, Windräder, Skilifte und Gondelbahnen. Wenn wir aus fossiler Energie hinausgehen, verändert sich damit auch die Landschaft. Der unterirdische Wald ist verbrannt, jetzt kommt die Fläche zurück mit Solarparks. Wir brauchen eine Ode an das Solarpanel, Hymnen auf die Windräder. Kulturell anders aufgeladene Bilder zu schaffen, das ist enorm wichtig, braucht aber Zeit und Effort
Wir müssen dafür ein kollektives Wir entwickeln. So nennen Sie es.
Ein neues kollektives Wir ist die eigentliche Utopie unserer Zeit. Wir sind ja in einer freiheitlichen Gesellschaft pluralisiert und leben die angesprochenen privaten Träume. Dementsprechend gibt es so viele Zukünfte wie Menschen. Wie lassen sich diese zusammenführen im Bewusstsein, dass wir immer auch verbunden mit anderen und der Natur sind? Unser Organismus ist keine Maschine, wir brauchen Luft und Lust zu leben, sonst kommt der kollektive Krankenstand. Weil aber die Angst vor Veränderung so gross ist, da sie nur auf Verzicht gestimmt ist, kann das Wir im Westen im Moment nicht wachsen – es geht ja schon in Europa nicht.
Die Politik arbeitet oft auch mit Bildern.
Das muss sie in einer beschleunigen Medienwelt auch, und zwar mit einfachen Bildern. Zum Beispiel Versorgungssicherheit beim Stromgesetz. Das Bild der autarken, unabhängigen Schweiz ist kulturell tief verankert – ob das in einer wirtschaftlich eng verflochtenen Welt immer sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Man sieht: Es gibt keine einfachen Probleme mehr, keine Heldengeschichten, nur die Mühen der Ebene. Das macht sich schlecht als Aufmacher für die Boulevardpresse.
Was fehlt Ihnen denn in dieser Kommunikation?
Offenheit, ganz einfach – und zwar im doppelten Sinne. Erstens weiss niemand, was die Zukunft bringt, das mag bedrohlich sein, eröffnet aber theoretisch einen immensen Gestaltungsraum. Dieser wird aber, zweitens, durch die Hochrechnung von Trends immer gleich wieder geschlossen – dann sieht Zürich 2050 immer so aus wie heute, nur mit etwas mehr Grün und Drohnen. Verschiedene Zukunftstechniken wie die Futures Literacy der UN beziehen die Menschen und ihre Annahmen mehr mit ein, so dass ein Dialog darüber entsteht, was sich ändern soll und in welchem Grad. Neben besseren Zielbildern fehlen auch die Prozessbilder, die uns veranschaulichen, was hier eigentlich vor sich geht: Von der Raupe zum Schmetterling oder doch nur grünes Face-Lifting?
Da setzt Imagineering an. Sie erklären es genauer an den Powertagen
Ich glaube, dass wir drei Ebenen des Wandels bespielen müssen. Die erste Ebene ist die Arbeit an Begriffen und Bildern, wie eben schon beschrieben. Die zweite Ebene ist die Veränderung kollektiver, routinisierter Handlungen. Soziale Praktiken wie der Energieverbrauch durch Mobilität (Auto, Zug, aber auch Datenmobilität) sind ein riesiger Hebel für Veränderung. Und drittens sind es auch individuelle Entscheidungen, die anderen wiederum als Vorbild dienen können – denken Sie an Greta Thunberg, die für das Klima in den Schulstreik geht. Diese ethische Perspektive allein reicht nicht und sie wird auch, wie z.B. mit dem individuellen Fussabdruck, oft missbraucht, um von grösseren Playern abzulenken. Aber schlussendlich müssen in einer Demokratie die Menschen etwas wirklich gemeinsam wollen, sonst scheitert alles.
Jörg Metelmann wir am Fachforum vom 6. Juni 2024 auftreten.
Über den Gesprächspartner
Jörg Metelmann, 53, ist Titularprofessor für Kultur- und Medienwissenschaft an der Universität St. Gallen. «Imagineering», die Kunst der Verbindung von Vorstellungskraft und Machbarkeit, ist ein Schlüsselbegriff für ihn. Er arbeitet aktuell an einem Buch über die Faktoren gelingender Transformation.